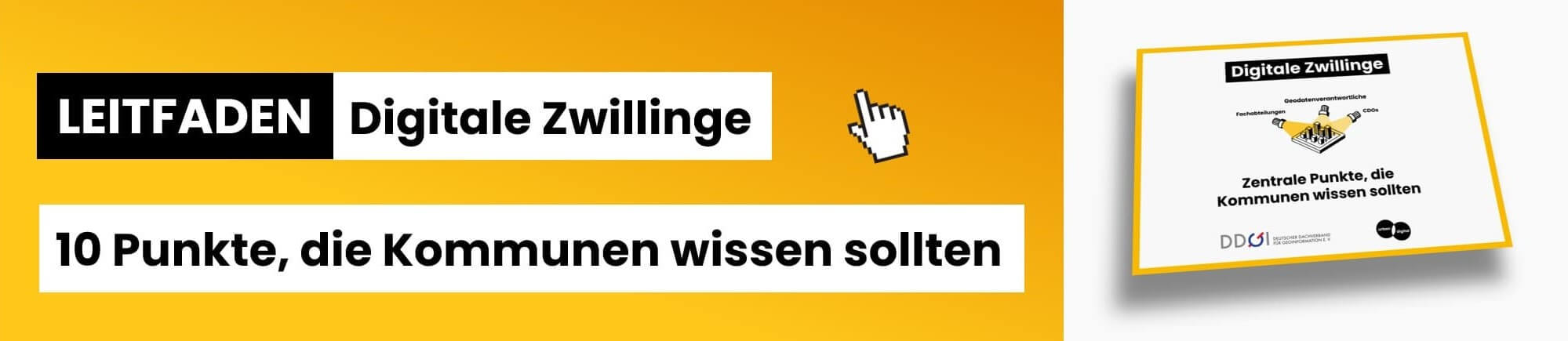Titelbild: Dr. Richard Vestner, Antje Dardin und Dimitri Ravin auf dem Year in Infrastructure & Going Digital Awards Event in Amsterdam
Dr. Richard J. Vestner ist Experte im Bereich digitale Infrastruktur und Stadtentwicklung. Als Vice President bei Bentley Systems setzt er sich für die Entwicklung und Umsetzung von digitalen Zwillingen ein. Auf der vergangenen Jahreskonferenz von Bentley Systems, The Year in Infrastructure und Going Digital Awards vom 15. bis 16. Oktober 2025 in Amsterdam, hat er die Industry Breakout Sessions zu Städten und Wasser moderiert.
Am Rande des Branchentreffens hat er uns im Gespräch erläutert, warum digitale Zwillinge mehr denn je dazu beitragen können, die Entscheidungsqualität von Städten und städtischen Unternehmen zu verbessern, wie BIM als Methodik der Zusammenarbeit verstanden werden sollte, wie sich Tief- und Hochbau stärker vernetzen lassen und welche Kompetenzen auch im KI-Zeitalter für eine erfolgreiche Umsetzung entscheidend sein werden.
Unseren fachlichen Austausch bereicherte Antje Dardin mit ihrer Perspektive, die als Global Product Marketing Manager bei Bentley Systems tätig ist.
1. Welche Use Cases treiben die Nutzung digitaler Zwillinge besonders voran?
Jede Stadt ist anders – und das zeigt sich auch bei der Anwendung digitaler Zwillinge. Manche Städte stehen stärker unter Druck durch den Klimawandel, andere kämpfen mit dem demografischen Wandel. Deshalb ist es wenig sinnvoll, Städte direkt miteinander zu vergleichen. Dennoch sehen wir weltweit wiederkehrende Anwendungsfelder.
Ein besonders präsentes Thema ist die Mobilität – und dabei geht es längst nicht mehr nur um den motorisierten Individualverkehr. In Dublin wird ein digitaler Zwilling genutzt, um „Active Travel“, also den Fuß- und Radverkehr, gezielt zu fördern. Damit können neue Routen und Infrastrukturmaßnahmen schon vor ihrer Umsetzung simuliert und bewertet werden. In Australien fließen unter dem Stichwort „Micromobility“ Daten aus E-Scooter- und Fahrradprojekten in digitale Zwillinge ein, um Wege sicherer und effizienter zu gestalten.
Ein weiterer zentraler Bereich ist die Energietransformation. Unsere Energiesysteme werden zunehmend vernetzt – Strom, Wärme und Kälte müssen heute gemeinsam geplant und gesteuert werden. In Dänemark sind ca. zwei Drittel der Haushalte an Fernwärmenetze angeschlossen, während Deutschland einen Anteil von etwa 14 % aufweist. ¹ Digitale Zwillinge unterstützen dabei, diese komplexen Netze zu modellieren, Ausbauszenarien zu simulieren und sektorübergreifende Lösungen sichtbar zu machen, was ein entscheidender Schritt zur Energiewende ist.

Auch die digitale Infrastruktur spielt eine wichtige Rolle, zum Beispiel beim Glasfaserausbau in bestehenden Stadtstrukturen. In Deutschland und Europa liegt der Schwerpunkt weniger auf völlig neuen Entwicklungen, sondern auf der intelligenten Einbindung neuer Infrastrukturen in das bestehende Umfeld.
Aus meiner Sicht ist es daher nicht zielführend, die Einführung digitaler Zwillinge ausschließlich auf häufige Use Cases zu stützen. Was den Durchbruch letztlich ermöglicht, ist die Visualisierung. Digitale Zwillinge schaffen Transparenz, indem sie verschiedene Infrastrukturebenen – von Energie über Verkehr bis Wasser – in einem Modell sichtbar machen. Das hilft Planern und Entscheidern, Zusammenhänge zu erkennen und bessere Entscheidungen zu treffen.
2. Welche Schritte haben Sie unternommen, um digitale Zwillinge noch stärker in Entscheidungsprozesse einzubinden?
Ein entscheidender Schritt war der Ausbau unserer Kompetenzen im Bereich der Geowissenschaften. Wir haben vor zwei Jahren Seequent übernommen, ein Unternehmen, das auf geowissenschaftliche 3D-Modellierung und Datenmanagement spezialisiert ist. Damit können wir die Stadt nicht nur oberirdisch, sondern auch unterirdisch abbilden – also genau dort, wo viele Infrastrukturfragen beginnen: Wo verlaufen Leitungen? Kann man dort bauen und was müsste dafür verlegt werden?
Das ist enorm hilfreich, um Fehlentscheidungen zu vermeiden. Denn uns allen sind die Fälle bekannt, bei denen Straßen mehrfach aufgerissen werden, weil zum Zeitpunkt der Entscheidung wichtige Informationen gefehlt haben. Mit KI lassen sich zusätzlich lokale Standards und gesetzliche Rahmenbedingungen in die Planung integrieren. So entsteht ein ganzheitliches Bild der Stadt, von oben bis tief nach unten.
Zudem haben wir mit Cesium eine weitere Akquisition getätigt. Cesium bringt eine Technologie, die wir aus der Gaming-Welt kennen in die Infrastrukturplanung: das performante Streaming großer 3D-Datenmengen mittels 3D-Tiles. Damit können wir komplexe Stadtmodelle flüssig und in hoher Dichte visualisieren und das macht die Arbeit mit digitalen Zwillingen deutlich angenehmer und zugänglicher.

3. KI verändert das Berufsfeld der AEC-Branche (Architecture, Engineering, Construction) bereits heute. Welche Fähigkeiten werden in Zukunft besonders wichtig sein?
Eine solide fachliche Ausbildung bleibt unverzichtbar – auch in einer von KI geprägten Arbeitswelt. Nur wer die von KI-Systemen erzeugten Informationen fachlich einordnen, prüfen und verifizieren kann, wird fundierte Entscheidungen treffen. Gleichzeitig gewinnt die Fähigkeit zum Management interoperabler KI-Systeme an Bedeutung, da diese im Zusammenspiel zuverlässig funktionieren müssen. Damit verbunden sind Haftungsfragen, die weiterhin für die menschliche Zusammenarbeit eine zentrale Rolle spielen.
Ebenso wichtig ist die Kommunikationsfähigkeit. Je stärker Fachdisziplinen digital vernetzt sind, desto entscheidender wird es, Informationen richtig zu interpretieren und weiterzugeben. In diesem Zusammenhang werden häufig auch Datensilos kritisiert. Ich sehe sie jedoch nicht grundsätzlich negativ: Arbeitsteilung und Spezialisierung sind Errungenschaften der industrialisierten Welt. Abteilungen existieren aus gutem Grund, denn sie bilden eher „Cylinders of Competence“. Entscheidend ist, dass der Informationsaustausch zwischen diesen Abteilungen funktioniert. Das erfordert eine Unternehmens- und Organisationskultur, in der Wissen aktiv geteilt wird – über Hierarchie- und Fachgrenzen hinweg. Entscheidungen müssen dabei dort getroffen werden, wo Risiken verstanden und verantwortet werden können.
Da der MINT-Nachwuchs die wachsende Nachfrage in vielen Bereichen nicht decken kann, setzen wir mit unseren Softwarelösungen genau hier an. KI hilft uns dabei, Prozesse zu automatisieren, Informationen besser zu verknüpfen und die Zusammenarbeit zwischen Fachdisziplinen zu erleichtern. So steigern wir die Produktivität und gleichen Ressourcenengpässe gezielt aus.
4. Wie sehen Sie Deutschland im internationalen Vergleich in Bezug auf den Einsatz digitaler Innovationen im Infrastrukturbereich?
Deutschland ist weiterhin ein Hightech-Land, aber die Bürokratie bremst Innovationen. Ich habe den Eindruck, dass die verantwortlichen Stellen daran arbeiten, diese Hemmnisse abzubauen, doch der Weg ist noch weit. Grundsätzlich brauchen wir mehr Risikobereitschaft und mehr Gestaltungsfreiheit für Städte und kommunale Unternehmen.
Ich sehe hier großes Potenzial für die Digitalisierung. Gerade unter dem politischen und öffentlichen Druck, einerseits Gebühren für städtische Dienstleistungen nicht zu erhöhen, trotzdem aber Spielräume für Investitionen in Erneuerung zu gewinnen, werden kreative und innovative Wege gefunden. Viele deutsche Städte und ihre Stadtwerke nutzen Daten und digitale Werkzeuge, um Infrastruktur und die Ver- und Entsorgung kostenbewusst und nachhaltig bereit- und sicherzustellen, obwohl der Aufwand dafür stetig steigt. Das zeigt, dass städtische Unternehmen nicht nur verlässliche Dienstleister sind, sondern auch wichtige Innovationstreiber im urbanen Umfeld.
Unser Software-Portfolio richtet sich genau an diese Akteure: an öffentliche Institutionen, Infrastrukturbetreiber und Dienstleistungsunternehmen. Viele Betreiber – etwa aus den Bereichen Energie, Wasser oder Verkehr – sind öffentlich organisiert. Für sie und ihre Dienstleister bieten wir Lösungen, die helfen, Effizienz und Innovationskraft zu steigern und gleichzeitig die Bürger:innen besser zu versorgen.
Wir danken Ihnen für das aufschlussreiche Interviewgespräch!
Quellen
¹ PlanEnergi. (2024, 3. Juni). Organisational structures in the Danish district heating sector (CoLab KWP Deliverable D). Danish Energy Agency / PlanEnergi. Abgerufen am 23. Oktober 2025, von https://www.dena.de/fileadmin/dena/Bilder/Projektportrait/CoLAB/2024_PlanEnergi_Ownership_2024.pdf
Germany Trade & Invest. (2023, 15. Dezember). Germany eyes big expansion of district heating. GTAI. Abgerufen am 23. Oktober 2025, von https://www.gtai.de/en/invest/industries/energy/germany-eyes-big-expansion-of-district-heating-1010730