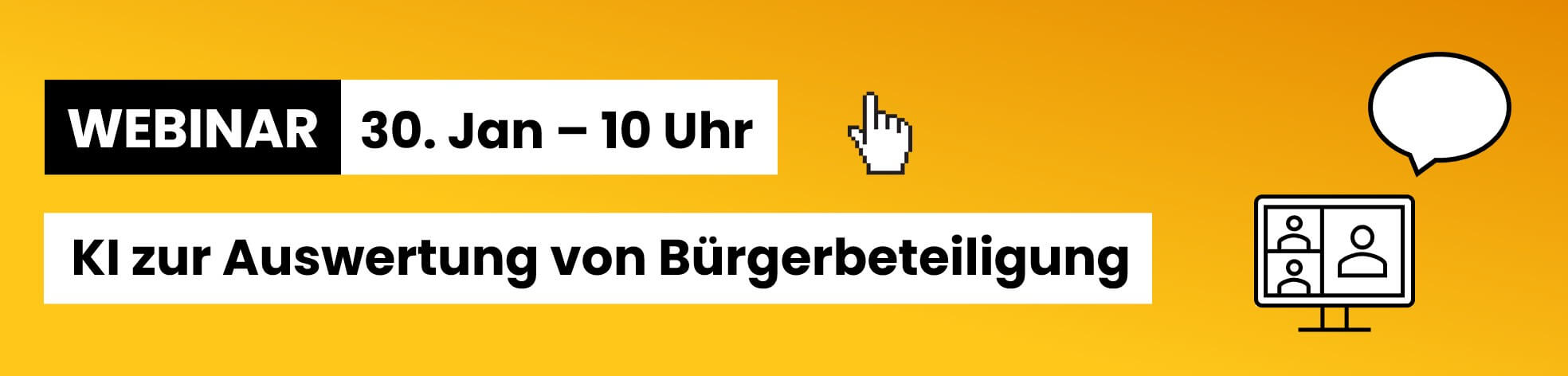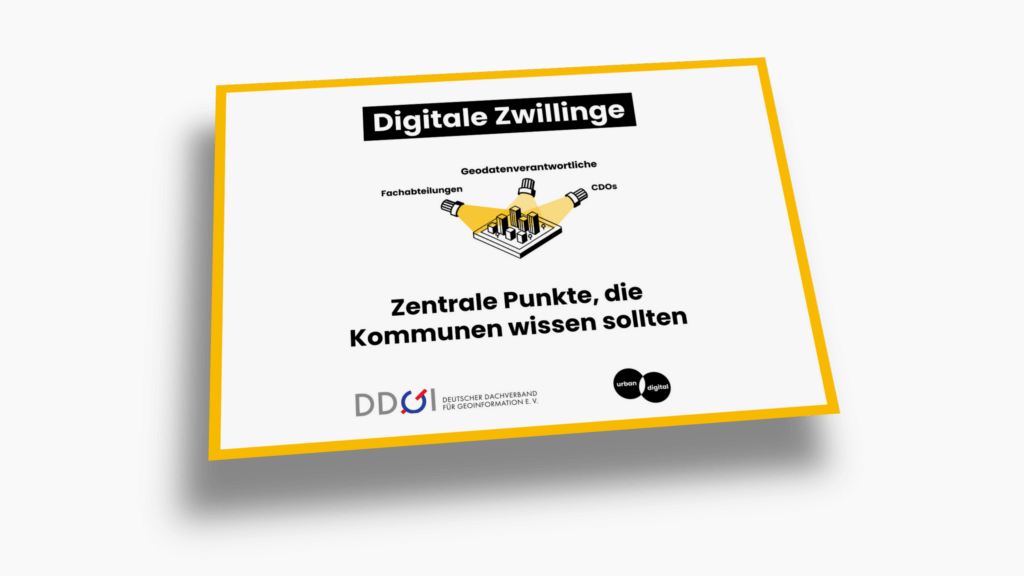Ralf Leufkes ist Geschäftsleiter des Vereins Civitas Connect e. V., einer bundesweit einzigartigen Kooperationsplattform für kommunale Unternehmen und Kommunen. Der 2020 gegründete Verein verfolgt das Ziel, den Austausch zwischen und die Zusammenarbeit von Städten, Kreisen und kommunalen Versorgungsunternehmen rund um die Digitalisierung kommunaler Infrastrukturen und Aufgaben zu fördern. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung gemeinschaftlich nutzbarer Lösungsbausteine für die digitale Daseinsvorsorge – praxisnah, übertragbar und mit Fokus auf Umsetzbarkeit.
Seit dem letzten Interview ist viel passiert: CIVITAS/CORE – Herzstück und Flaggschiff der Vereinsarbeit wurde weiterentwickelt, die Open-Source-Strukturen und -governance rund um das Entwicklungsprojekt wurden ausgebaut und das Thema digitale Souveränität hat auch in der politischen Debatte sowie in der kommunalen Praxis deutlich an Bedeutung gewonnen.
In diesem Jahr sprechen wir mit Ralf Leufkes darüber, wie Open-Source-Projekte im kommunalen Kontext funktionieren, welche Rolle eine kommunal gesteuerte Softwareentwicklung spielen kann – und warum die CIVI/CON 2025 am 4. September 2025 in Wuppertal, ein zentraler Treffpunkt für alle ist, die Digitalisierung kommunal, souverän und kooperativ gestalten wollen.
1. Die CIVI/CON findet dieses Jahr zum dritten Mal statt. Was ist seit der letzten Ausgabe passiert – inhaltlich, organisatorisch oder im Umfeld von Civitas Connect?
Seit der letzten CIVI/CON hat sich im Verein sowie rund um den CIVITAS/CORE als zentrales Entwicklungsprojekt einiges getan – inhaltlich wie auch strukturell. Unsere Community rund um die CIVITAS/CORE-Datenplattform ist gewachsen, ebenso wie das Bewusstsein für digitale Souveränität als zentrales kommunales Zukunftsthema. CIVITAS/CORE hat sich als zentrale Infrastrukturplattform weiterentwickelt – insbesondere durch die Öffnung hin zu einem echten Open-Source-Ökosystem mit klarer Governance. Auch politisch hat das Thema Fahrt aufgenommen: Wir merken, dass digitale Souveränität immer stärker als Voraussetzung für nachhaltige Digitalisierung verstanden wird – nicht als Luxus.
Video-Rückblick Civitas Connect 2024
2. Das Programm der CIVI/CON 2025 ist stark auf Praxisbeispiele und konkrete Anwendungen wie urbane Datenplattformen und digitale Zwillinge ausgerichtet – warum war Ihnen das besonders wichtig?
Wir sprechen oft abstrakt über Digitalisierung – aber Transformation gelingt nur, wenn wir konkret werden. Deshalb legen wir den Fokus 2025 auf Umsetzbarkeit und Transfer: Was funktioniert schon heute? Was kann man adaptieren? Und wie kommen Kommunen in die Umsetzung? Wir zeigen Projekte wie den digitalen Zwilling oder CORE-Implementierungen aus Bonn und Wuppertal, aber auch, wie Hands-on-Workshops echten Mehrwert stiften. Unsere Devise: weniger Hochglanzfolien, mehr Erfahrungswissen.
Wir sehen ein stark wachsendes Interesse – aber auch große Unterschiede im Reifegrad. Manche Kommunen sind Vorreiter, andere stehen am Anfang. Was allen hilft, sind modulare, anschlussfähige Architekturen und offene Standards. Digitale Zwillinge entfalten ihren Nutzen erst durch gute Dateninfrastrukturen im Hintergrund. Modellzentrierung – also das strukturierte Denken in Use-Cases auf einer stabilen Infrastruktur – ist ein Schlüssel. Große Hebel liegen in der Wiederverwendung, der Skalierung und in der konsequenten Nutzung offener Plattformen.
3. In der öffentlichen Debatte wird viel über digitale Souveränität gesprochen. Was bedeutet das konkret im kommunalen Alltag und was sind aus Ihrer Sicht die zentralen praktischen Herausforderungen?
Digitale Souveränität bedeutet für Kommunen vor allem Kontrolle: über Daten, IT-Architekturen und die Entwicklung zentraler Dienste. Es geht darum, unabhängig entscheiden zu können, wie Software betrieben, weiterentwickelt und finanziert wird. In der Praxis sind die Herausforderungen vielfältig: fehlende Ressourcen, unsichere Förderstrukturen, geringe Standardisierung.
Und nicht zuletzt: ein oft zu starker Fokus auf proprietäre Lösungen. Open Source und offene Governance sind hier keine Ideologie, sondern handfeste Voraussetzungen für Handlungsfähigkeit und Kooperation.
4. CIVITAS/CORE ist als Open-Source-Projekt konzipiert, aber wie funktioniert so ein Entwicklungsprozess konkret im kommunalen Umfeld?
Anders als bei klassischen IT-Projekten ist der Entwicklungsprozess bei CIVITAS/CORE kollaborativ und dezentral. Kommunen definieren gemeinsam Anforderungen, neutral koordiniert durch den Verein. In diesem Anforderungsmanagement arbeiten wir die gemeinsamen Anforderungen heraus und schaffen Anschlussfähigkeit zur Umsetzung individueller Wünsche. Der Fokus in der gemeinsamen Entwicklung liegt dann auf den gemeinsamen Anforderungen.
Dieser vorgelagerte Prozess ist elementar und die Basis für eine gemeinsame Entwicklung. Dazu setzen wir auf Rollenverteilung: Entwicklung erfolgt oft durch Dienstleister, aber die Steuerung liegt bei den öffentlichen Akteuren. Dieses Modell unterscheidet sich von vielen anderen Projekten durch eine klarere Governance, eine offene Roadmap und eine konsequente Vermeidung von Vendor Lock-ins. Es ist ein lernender Prozess – aber einer, der Vertrauen schafft und Souveränität ermöglicht.
CIVITAS/CORE kann grundsätzlich von allen genutzt werden – warum gibt es trotzdem gute Gründe, Mitglied bei Civitas Connect zu werden?
Offene Nutzung ist ein Grundprinzip, aber die aktive Gestaltung passiert bei uns in der Community. Als Mitglied in der CIVITAS/CORE Community hat man Zugang zu Steuerungskreisen, kann strategisch an der Weiterentwicklung von CIVITAS/CORE mitwirken und die Roadmap mitbestimmen. Außerdem koordinieren wir aus neutraler Rolle zentrale Update-Flüsse und übernehmen Verantwortung für die Community-Architektur.
Das ist essenziell, wenn man langfristig planen und mitentwickeln möchte. Mitgliedschaft bedeutet nicht nur Mitfinanzierung, sondern echten Einfluss – ohne Zwang zur Nutzung. Das macht unsere Plattform einzigartig. Darüber hinaus sorgt eine breite Community auch für überschaubare Kosten für Wartung und Community. Das ist die Basis, um auch ohne Fördermittel ein solches Projekt über Jahrzehnte aufrecht zu halten.
5. Open Source ist in aller Munde. Sie verfolgen in Bezug auf Open Source das Modell einer Software-Foundation. Was unterscheidet diesen Ansatz von anderen Open-Source-Communitys / Projekten?
Wir verfolgen einen klar strukturierten, gemeinwohlorientierten Ansatz: Die Steuerungshoheit über die Weiterentwicklung liegt bei den Kommunen – nicht bei einzelnen Dienstleistern oder Unternehmen. Das ist entscheidend, um echte digitale Souveränität zu gewährleisten. Unsere Vereinsstruktur sorgt für Verbindlichkeit in der Weiterentwicklung, schafft Transparenz und vermeidet die Gefahr des sogenannten „Open-Source-Washings“.
Wir setzen auf eine neutrale, offen organisierte Governance, die technologische Innovation mit institutioneller Verantwortung verbindet. Das ist mehr als nur Open Code – es ist ein System zur Selbstbestimmung im digitalen Raum und schafft so die Basis für ein wachsendes Ökosystem an Dienstleistenden, die unter gleichen Bedingungen im Wettbewerb stehen. So vermeiden wir den Aufbau von Dienstleisterabhängigkeiten bei allen Nachnutzern unserer Software – ob Vereinsmitglied oder nicht.
Und zum Abschluss: Was erwarten Sie persönlich von der CIVI/CON 2025? Woran würden Sie festmachen, dass sie erfolgreich war?
Ich wünsche mir echten Austausch auf Augenhöhe – zwischen Kommunen, Entwicklern, Politik und der Kommunalwirtschaft. Wenn neue Allianzen entstehen, konkrete Projekte angestoßen werden und wir ein gemeinsames Verständnis davon mitnehmen, was digitale Souveränität im kommunalen Alltag bedeutet, dann war die CIVI/CON ein Erfolg. Es geht nicht nur um Fachvorträge, sondern um Vernetzung, Vertrauen und die Lust, gemeinsam weiterzumachen. Wir brauchen diese Räume, um Transformation nicht nur zu diskutieren, sondern aktiv zu gestalten.
Wir danken Ihnen für das inspirierende Interview und freuen uns auf eine spannende Veranstaltung sowie das Wiedersehen in Wuppertal am 4. September!