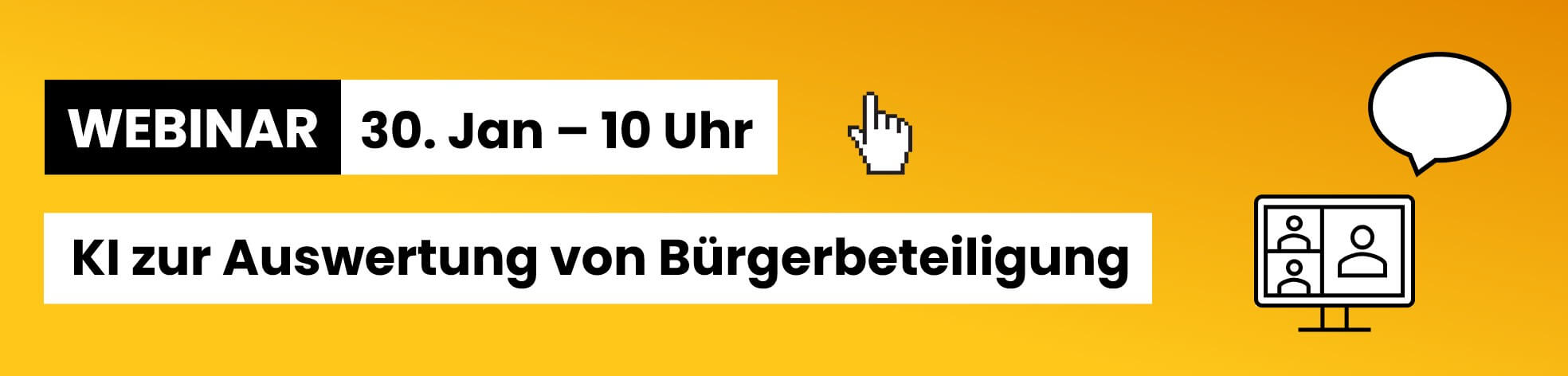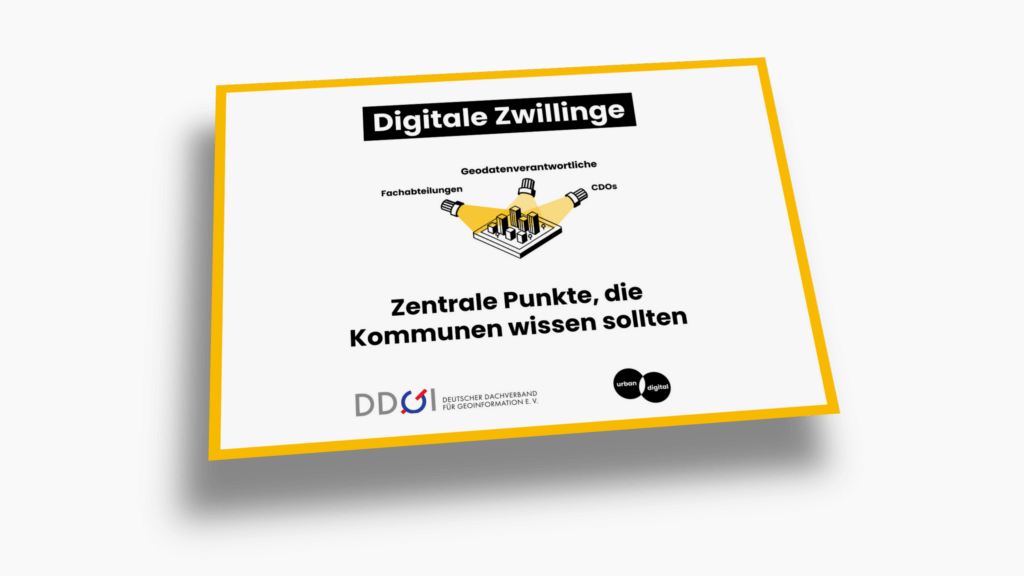Autorin: Claire Piqueret Rose
Den Zugang zum Digitalen Zwilling beschleunigen – Ein Schlüssel zum Aufbau einer Kultur des Risikomanagements in ländlichen Gemeinden
Die Zunahme von Extremwetterereignissen, insbesondere Starkregen und Hochwasser, war im Herbst 2024 in ganz Europa zu beobachten. Im September waren weite Teile Süddeutschlands von massiven Überschwemmungen betroffen. Im Oktober wurden erneut vor allem kleine Gemeinden, z.B. in Frankreich und Spanien, mit lebensbedrohlichen Ereignissen für die Bevölkerung konfrontiert. Vonseiten der Bewohner:innen wird dabei immer wieder die fehlende Vorplanung sowie die unzureichende Transparenz über Vorgänge und Maßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes kritisiert.Solche Ereignisse werden sich auch in Zukunft nicht gänzlich vermeiden lassen, doch durch gezielte Präventionsmaßnahmen können ihre Auswirkungen auf Menschen und Infrastruktur erheblich gemindert und bestenfalls verhindert werden. Ländliche Kommunen in Europa, auch in Deutschland, weisen weiterhin Nachholbedarf auf, was die technische und organisatorische Ausstattung im Hinblick auf den Katastrophenschutz angeht.
1. Smartes Hochwasser- und Starkregenmanagement
Zur Erstellung von Katastrophenschutzplänen stellt die Implementierung eines Digitalen Zwillings zur Prävention von Hochwasserschäden eine vielversprechende Methode dar – auch für kleinere und ländliche Gemeinden. Er ermöglicht eine detaillierte Erfassung und Pflege von Gebietsinformationen, wodurch eine präzise Diagnose und Analyse (sowie eine proaktive Planung) im Katastrophenschutz unterstützt wird.
Speziell im Kontext von Starkregenereignissen bezeichnet ein Digitaler Zwilling ein digitales Modell bzw. eine virtuelle Repräsentation eines physischen Systems [1]. Die Echtzeiterfassung von Umweltdaten, beispielsweise von Niederschlägen und Flusspegelständen, sowie deren Integration in den Digitalen Zwilling ermöglichen die Erstellung präziser Vorhersagen über potenzielle Hochwassergefahren. Die Simulation diverser Szenarien, wie zum Beispiel die Analyse der Auswirkungen von Starkregenfällen oder dem Bruch eines Dammes, ermöglicht es vorbeugende Maßnahmen gezielt zu ermitteln. Für Behörden können so auch Notfallpläne und der Einsatz von Rettungskräften mithilfe des Digitalen Zwillings optimiert werden. Evakuierungen können simuliert und die sichersten Rettungsrouten zu betroffenen Gebieten ermittelt werden.
2. Kommunikation mit Bürger:innen führt
zum Aufbau einer Risikokultur
Vor der Katastrophe: Aktive Sensibilisierung der Bevölkerung
Im Bereich des Katastrophenschutzes gilt es, die Kommunikation vor und während des Notzustands zu unterscheiden. Bürger:innen müssen einen transparenten Zugang zu Informationen erhalten. Es müssen regelmäßige Informationsveranstaltungen zum Thema organisiert sowie Inhalte pädagogisch und in leicht konsumierbarer Form zur Verfügung gestellt werden.
“To raise awareness about risks and their evolution due to climate change, experts and public authorities should meet people where they are—both conceptually, by acknowledging and addressing their concerns, and practically, by engaging with them in their daily environments, such as workplaces, social activities, neighborhoods, and community events.”
Zitat von Dr. Cassandre Rey-Thibault, Forscherin im Bereich Risiko- und Krisenmanagement at Sciences Po Paris[2]
Klassische Flyer, Videos oder Checklisten sind Beispiele für solche Materialien, um eine breite Zielgruppe zu erreichen. Unterrichtsmaterialien, Ratgeber und allgemeine Checklisten sind auf der Webseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zu finden [3]. Das BBK hat zudem das Onlinespiel „Max & Flocke: Jagd auf Dr. Superschreck“ konzipiert, um beizubringen, wie man sich in Notsituationen richtig verhält [4]. Als weitere Maßnahme können Live-Übungen durchgeführt werden. In Frankreich gibt es einen obligatorischen Krisenplan mit detaillierten Maßnahmen (PPMS) [5] für jede Schule sowie eine jährliche Übung. Einen tieferen pädagogischen Charakter repräsentieren E-Learning-Module oder sogenannte Serious Games (dt.: Planspiele), die die Eckdaten und wesentliche Inhalte, wie z.B. aus dem lokalen Katastrophenschutzplan aufgreifen und spielerisch sowie verständlich vermitteln. Ein gutes Beispiel ist das Serious Game (franz. Jeu sérieux) aus Frankreich „Plonevez-les-Flots“ [6], welches sowohl in Masterstudiengängen als auch in Fortbildungen für Bürgermeister:innen und Beamt:innen zur Sensibilisierung für das Thema Überschwemmungen genutzt wird. Auch das Serious Game „Stop Disaster“ [7], entwickelt von der UN, ist eine erprobte pädagogische Methode, um bei Jugendlichen frühzeitig ein Verständnis für Risikomanagement zu fördern.
Neben der Sensibilisierung der Bevölkerung und der Verwaltung müssen laufend Erfahrungen und der gelernte Umgang aus vergangenen Katastrophen aufrechterhalten werden. Dies hilft, von einem Top-down-Informationsaustausch zu einem Ansatz der lokalen Animation rund um eine verinnerlichte und geteilte Risikokultur überzugehen [8].
Während der Katastrophe: Digitale & analoge Meldungen
Es ist wichtig, dass Warnungen zeitnah direkt bei der Bevölkerung ankommen, z. B. direkt auf dem Smartphone. Hierfür können beispielsweise die Smart-City-Apps der Kommunen genutzt werden. Auch das Cell-Broadcast-Verfahren hat sich als effektives Warnmittel etabliert: Nordrhein-Westfalen ist der deutsche Spitzenreiter beim Einsatz dieser Lösung. [9]
Beim Cell-Broadcasting ist es wichtig, dass Kommunen es selber nutzen dürfen und somit die Warninhalte selbst festlegen können, was beispielsweise in Frankreich nicht der Fall ist. [10] Ein weiteres wichtiges Warnmittel ist ein gut ausgebautes Sirenennetz. Momentan wird dies in Deutschland erweitert.
3. Intra- und interkommunale Zusammenarbeit im Hochwasserschutz
Der Aufbau eines Digitalen Zwillings ermöglicht es, Datensilos zwischen verschiedenen Abteilungen aufzulösen, Daten zentral zugänglich zu machen und für Analysen und Simulationen zu nutzen. Dies fördert eine institutionalisierte Zusammenarbeit und schafft beschleunigte Verwaltungsprozesse.
Um einen effizienteren Hochwasser- und Katastrophenschutz zu implementieren, muss auf der richtigen territorialen Ebene gehandelt werden. In den meisten Fällen ist eine interkommunale Zusammenarbeit erstrebenswert oder unabdingbar. Sollten gemeinsame Entwicklungen auf Landkreisebene nur langsam vorankommen, sollten Kooperationen auf Gemeindeverbundebene oder zwischen Nachbarstädten angestrebt werden. Diese können zu einem späteren Zeitpunkt auf interkommunaler Ebene skaliert werden. Eine frühzeitige Kooperation fördert die Interoperabilität der erarbeiteten Lösungen sowie einen schnellen gegenseitigen Informationsaustausch und Unterstützung.
Umsetzungsbeispiel der Nachbarstädte Deggendorf und Plattling
Für ein zukunftsfähiges Katastrophenmanagement nutzen die Nachbarstädte Deggendorf und Plattling einen Digitalen Zwilling, der mithilfe des Förderprogramms „TwinBy – Digitale Zwillinge für Bayern“ des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales entstehen konnte. Die aconium GmbH hat die beiden Städte bei diesem Vorhaben begleitet – sowohl bei der Use-Case-Entwicklung als auch bei der technischen Umsetzung.
4. Fazit
Um das volle Potenzial Digitaler Zwillinge auszuschöpfen, müssen diese als zentrale Grundlage für die Erstellung einer territorialen Diagnose anerkannt werden. Sie müssen jedoch mit der Weiterentwicklung regulatorischer Instrumente und dem Aufbau einer Risikokultur einhergehen. Die frühzeitige und kontinuierliche Einbeziehung der Bevölkerung sowie diverser Interessensgruppen ist ebenfalls zentral, um eine effiziente Umsetzung der Notfallpläne zu sichern. Autorin: Claire Piqueret Rose, Leitung Smart Cities & Regions, aconium GmbH
Claire Piqueret Rose
Leitung Smart Cities & Regions
aconium GmbH
LinkedIn-Profil
Quellen
- [1] https://aconium.eu/digitaler-zwilling-im-hochwasserschutz-eine-zukunftsweisende-technologie-zur-schadensminimierung-und-risikoanalyse/
- [2] Freigegebenes Zitat aus dem vom Claire Piqueret Rose geführten Interview am 19. Dezember 24.
- [3] https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Sicherheit-durch-Vorsorge/Materialien-Hochwasser/materialien-hochwasser.html?nn=20098#vt-sprg-4
- [4] https://www.max-und-flocke-helferland.de/DE/Spielen/spielen_node.html#doc79024bodyText1
- [5] Plan particulier de mise en sûreté (PPMS), https://www.education.gouv.fr/bo/2023/Hebdo26/MENE2307453C
- [6] https://www.risques-cotiers.fr/seformer/miseensituation/
- [7] https://www.undrr.org/children-and-youth/stop-disasters-game
- [8] https://www.cerema.fr/fr/actualites/culture-du-risque-clefs-mieux-impliquer-populations
- [9] https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/02/pm-20-1-jahr-cell-broadcast.html?nn=85578
- [10] https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221003354.html