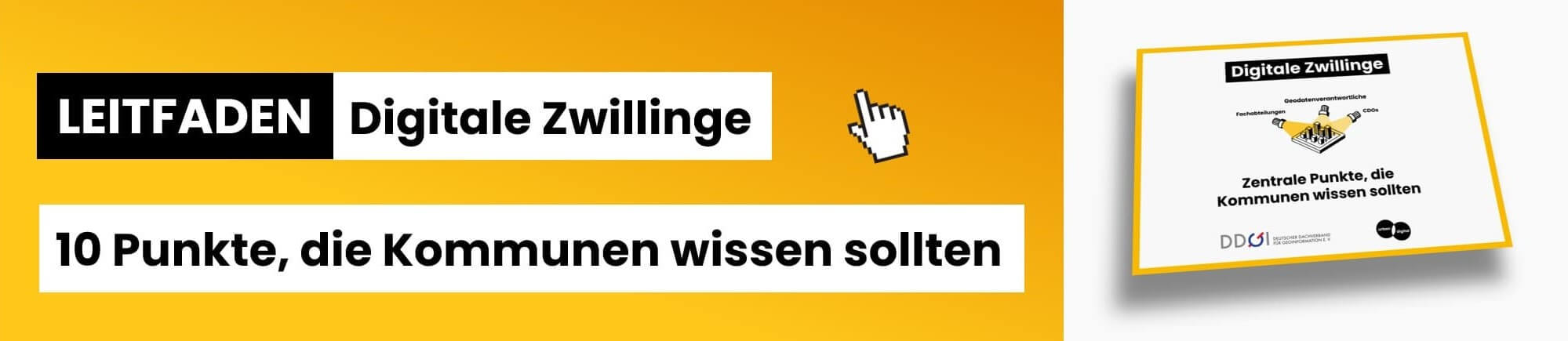Realisierungskonzepte für LoRaWAN in Kommunen und Stadtwerken
LoRaWAN ist für viele Kommunen und Stadtwerke das Rückgrat digitaler Anwendungen – von Wasser- und Pegelmessung bis zur Energieüberwachung.
Doch bevor die ersten Gateways installiert werden, muss eine strategische Grundsatzentscheidung getroffen werden:
Wie soll das Netz betrieben werden, und wie offen oder sicher soll es sein?
Die vier folgenden Konzepte zeigen erprobte Wege, wie Kommunen und Stadtwerke ihr LoRaWAN schrittweise oder vollständig realisieren können.
Standard LoRaWAN-IoT – Netz für die Smart City
Das klassische kommunale oder stadtwerkseigene LoRaWAN-Netz. Hier wird das Netz als „städtische Infrastruktur“ konzipiert und kann – je nach Strategie – von der Kommune selbst oder vom Stadtwerk betrieben werden.
Typische Merkmale sind der Aufbau als städtisches oder stadtwerkseigenes Netz, die Mitnutzung durch Dritte (z. B. kommunale Betriebe oder Partner) sowie der Einsatz für verschiedenste Smart-City-Anwendungen.
Die Realisierung kann im Eigenbetrieb oder als Managed LoRaWAN-Service erfolgen.
Vorteile: Klare Verantwortlichkeiten, direkte Kontrolle über Daten und Betrieb
Herausforderungen: Regulatorische Pflichten (z. B. BNetzA-/BSI-Meldung), eigener Betriebsaufwand
Shared LoRaWAN-IoT – Kommunales + gemeinschaftliches Netz
Dieses Modell setzt auf Kooperation: Kommune, Stadtwerk und offene Netzwerke (z. B. The Things Network) betreiben gemeinsam eine Infrastruktur.
Daten können in gemeinsamen Plattformen gebündelt und für verschiedene Anwendungen genutzt werden.
Typisch ist die Kombination verschiedener Netzserver, die gemeinsame Nutzung von Gateways und Infrastruktur sowie die Integration offener Daten und Plattformen wie Element IoT.
Vorteile: Synergien, geteilte Infrastrukturkosten, Förderung offener Datenstrategien
Herausforderungen: Abstimmungsaufwand, komplexere Kopplung mehrerer Netzwerkserver
Ein Shared-Netz erfordert meist Proxy- oder Vermittlungsserver, um Datenflüsse aus mehreren Quellen sicher zu koordinieren.
Formal LoRaWAN-IoT – „Sichere“ Daten über LoRaWAN
Wenn kritische Infrastrukturen oder sensible Messdaten übertragen werden sollen, greift das formale Modell.
Hier wird LoRaWAN mit einem sicheren Kommunikationskanal gemäß BSI TR-03109-5 betrieben.
Typisch ist der Einsatz des CLS-Kanals (Controllable Local System) über das Smart-Meter-Gateway, wodurch der Datentransport BSI-konform erfolgt.
Das Modell eignet sich besonders für Energieversorger und Netzbetreiber, die strenge Sicherheitsvorgaben erfüllen müssen.
Vorteile: Maximale Datensicherheit und Compliance
Herausforderungen: Technisch anspruchsvoll, höhere Anforderungen an Netzarchitektur und Betrieb
All-In LoRaWAN-IoT – Umfassendes Netz für die Smart City
Das All-In-Modell kombiniert alle Ansätze und schafft eine einheitliche, stadtweite IoT-Infrastruktur.
Hier fließen Sicherheitsanforderungen (BSI-konform), offene Datenansätze und verschiedene Betriebsebenen zusammen.
Typisch sind die Kombination aus Managed Service und eigenem Netzaufbau, die Integration eines CLS-Kanals sowie die Bereitstellung offener Daten über Smart-City-Plattformen.
Vorteile: Zukunftssicher, kombinierbar, höchste Flexibilität
Herausforderungen: Bedarf an klarer Governance zwischen Kommune, Stadtwerk und Partnern
Fazit
Die vier Realisierungskonzepte zeigen, dass LoRaWAN kein starres System ist, sondern modular gedacht werden kann.
Von einem ersten Pilotnetz bis zur sicheren, offenen Smart-City-Infrastruktur – entscheidend ist, frühzeitig festzulegen, wer das Netz betreibt, wie offen die Daten sein sollen und welche Sicherheitsstandards erfüllt werden müssen.
Praxis-Tipp: Klären Sie Zuständigkeiten zwischen Kommune und Stadtwerk von Anfang an – insbesondere für Betrieb, Wartung und Datenmanagement. So vermeiden Sie spätere Reibungsverluste und schaffen eine tragfähige Grundlage für zukünftige Smart-City-Anwendungen.